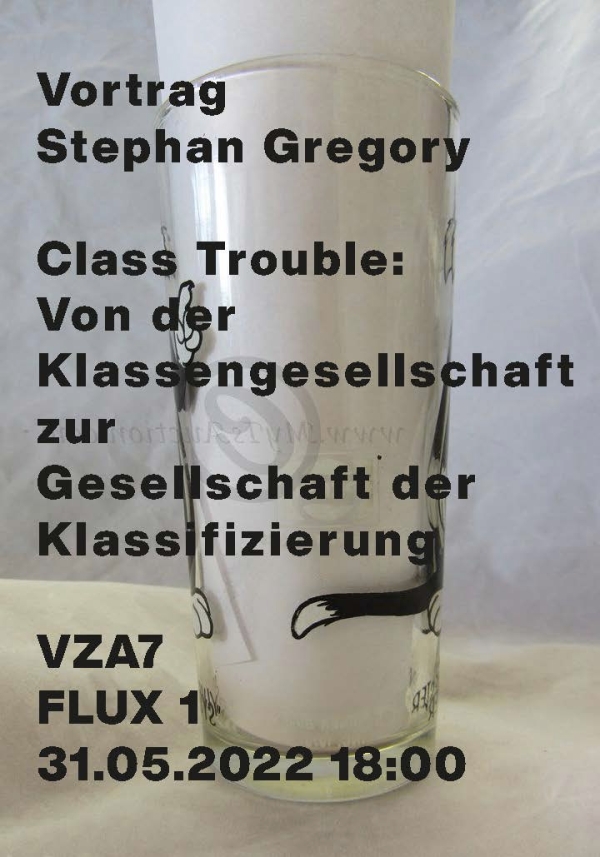Eine Veranstaltung der Abteilung Kunsttheorie
Das
Buch »Class Trouble« unternimmt eine Reise zu den Ursprüngen der modernen Klassengesellschaft. Am Beispiel Englands wird gezeigt,
wie die Menschen des 17. und 18. Jahrhunderts auf die Idee gekommen sind, dass ein gesellschaftliches Ganzes in Klassen geteilt
sei – und nicht etwa in Stände, Ränge, Handwerke oder Clans.
Der Fokus
der Untersuchung liegt auf den Diskursen, Medien und Verfahren, durch die sich das Prinzip der Klassenteilung effektiv durchsetzte.
Neben den bevölkerungspolitischen Sortiertechniken der Politischen Arithmetik sind es vor allem die ›Neuen Medien‹ von 1700
(Kaffeehaus, Club, Zeitung, Zeitschrift), die als Agenturen einer klassifikatorischen Neuordnung des Sozialen verstanden werden
können.
Im Vortrag soll angedeutet werden, wie eine solche genealogische Perspektive dazu beitragen
kann, auch die heutigen Prozesse einer Neuformatierung des Sozialen genauer in den Blick zu bekommen. Was als ›Ende der Klassengesellschaft‹
beschrieben wurde, bezeichnet keineswegs das Ende der klassenförmigen Einteilung der Gesellschaft, sondern nur den Übergang
zu einem anderen Modus der Klassifizierung. Statt einer Gegenüberstellung großer, statischer Klassen-Blöcke findet man nun
ein allumfassendes System der Mikroklassifizierung, der permanenten wertenden Einschätzung und Neugruppierung aller Elemente
und Beziehungen nach wechselnden Einteilungskriterien. Merkwürdigerweise kommt das Denken der Klasse damit auf Muster und
Mechanismen zurück, die zur Frühzeit der sozialen Klassenteilung gehören. Ausgehend von den in »Class Trouble« beleuchteten
Schicksalen des frühen Klassenbegriffs lässt sich eine Diskussion darüber angehen, wie heute Gesellschaft ›formatiert‹ wird,
welche Formen der Neuaufteilung des Sozialen sich aus den politischen Technologien und medialen Zurichtungen der Gegenwart
ergeben.