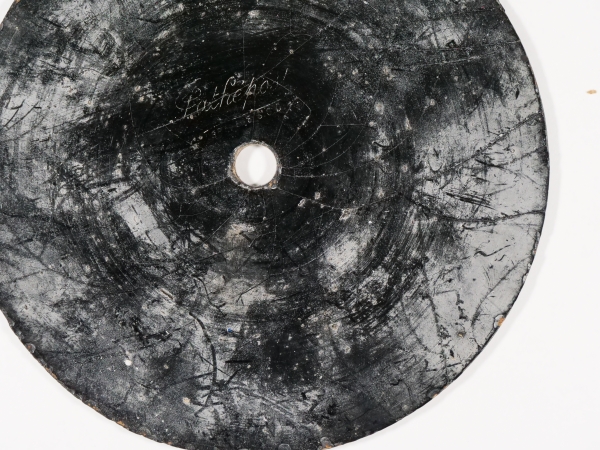Projektleiterin: Eva Hallama
Institut für Bildende und Mediale Kunst - Abteilung Medientheorie
Laufzeit: 11/2021
- 10/2025 [an der Angewandten von 05/2024 - 10/2025]
Heritage Science Austria – Programm der Österreichischen Akademie
der Wissenschaften,
https://www.oeaw.ac.at/foerderungen/foerderprogramme/heritage-science-austria/,
Heritage_2020-88_SONIME
Das Projekt SONIME sammelt und beforscht Audiobriefe, die sich
in öffentlichen Archiven verbergen oder sich in Privatbesitz befinden, und die seit Beginn der Tonaufzeichnung bis zur Etablierung
digitaler Formate aus, nach und innerhalb von Österreich meistens per Post versendet worden sind. Im Fokus stehen die Kulturtechnik
des akustischen Briefs im 20. Jahrhundert, Fragen nach der Spezifität dieses Mediums wie die Intimität des Akustischen, die
Flüchtigkeit und Affektivität der Stimme, die besonders in Zeiten der Getrenntheit bedeutsam werden, sowie materialtechnische
und konservatorisch-restauratorische Aspekte seltener Audiomedien wie Direktschnittplatten, magnetischer Selbstaufnahmeplatten
oder Diktierkassetten.
In Kooperation mit dem Phonogrammarchiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften [Link:
https://www.oeaw.ac.at/phonogrammarchiv/home] und der Österreichischen
Mediathek des Technischen Museum Wien [Link:
https://www.mediathek.at/] werden die
historischen und teilweise von Materialabbau bedrohten Tonaufnahmen auf Wachswalzen, Tondraht, Direktschnitt-Schallplatten,
Magnettonband und diversen Kassettenformaten restauriert, wissenschaftlich untersucht, archiviert, digitalisiert und langzeitgesichert.
Die neu aufgebaute und zugänglich gemachte Referenzsammlung wird unter Einbeziehung des Wissens der Übergeber*innen aufgebaut,
mit denen Interviews über die Bedeutung der Audiobriefe als "memory objects” geführt werden.
Ziel des Projekts ist es,
die maßgeblichen Entwicklungen, Materialien und Eigenschaften des akustischen Briefes sowohl aus kulturhistorischer wie auch
aus restauratorischer und materialanalytischer Perspektive beschreiben zu können. Die Referenzsammlung, die dazugehörigen
Metadaten und die im Projekt entstandenen Forschungsergebnisse werden als Open Access Data für weitere Forschung zur Verfügung
stehen und zukünftige interdisziplinäre Forschungsarbeiten in diesem Bereich anregen und ermöglichen.
Bildcredits:
Pathépost-Platte, ca. 1908, Signatur: 1-01895 (Österr. Mediathek), Foto: Hallama